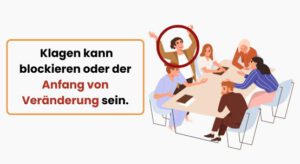Doch was dabei leicht übersehen wird: Hilfe kann auch eine Falle sein.
- Weil Helfen der einzige Weg war, Zugehörigkeit zu sichern.
- Weil Nein sagen als Schwäche gelesen wurde.
- Weil sie nie erfahren hat, dass ihre Ideen zählen.
Warum in Teams Kompetenzen oft brachliegen
Wenn in einem Team immer dieselben einspringen, hat das selten nur mit Hilfsbereitschaft zu tun. Oft ist es ein erlerntes Muster: Wer Zugehörigkeit vor allem durch „Machen“ sichern konnte, bleibt in dieser Rolle stecken – auch wenn andere längst eigene Verantwortung übernehmen könnten.
In Kulturen, in denen „Nein sagen“ als Schwäche gilt, verfestigt sich dieses Muster. Das Ergebnis: Manche Teammitglieder werden zu stillen Dauerlösern, während andere ihre Kompetenzen seltener einbringen.
Für Führungskräfte heißt das: Nicht nur auf die Hilfsbereitschaft schauen, sondern auch darauf, welche Chancen für Teamentwicklung dabei liegenbleiben.
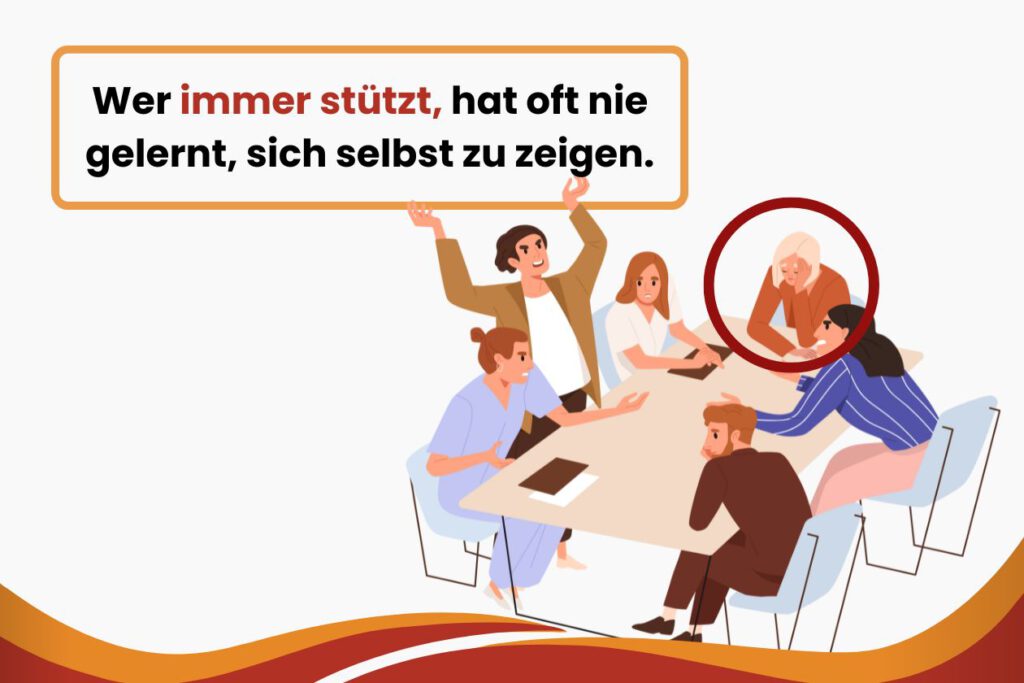
Wie Führungskräfte verdeckte Helferrollen erkennen
Hilfsbereitschaft wirkt positiv, kann aber unbewusst das Team aus dem Gleichgewicht bringen. Achte als Führungskraft darauf, ob:
- dieselben Personen immer wieder zentrale Aufgaben übernehmen, auch wenn andere Kapazitäten hätten.
- bestimmte Mitarbeitende ihre eigenen Projekte hintanstellen, um andere zu entlasten.
- Ideen oder Beiträge aus dem Helferkreis seltener in strategische Diskussionen einfließen.
Solche Muster sind nicht nur eine Frage der Arbeitslast, sie bestimmen, wie Kompetenzen im Team genutzt oder ungenutzt bleiben.
3 Schritte, um die Rollenverteilung im Team konstruktiv zu unterbrechen
-
Hilfe anerkennen
„Danke, dass du dich anbietest! Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann.“
(Damit fühlt sich die Person nicht übergangen oder kritisiert.) -
Helferperson anders einbinden
„Deine Erfahrung ist wertvoll! Deswegen möchte ich, dass du diesmal als Sparringspartnerin unterstützt, während jemand anderes die Umsetzung übernimmt.“
(So bleibt der Helfer aktiv eingebunden und gibt Wissen weiter.) -
Blick ins Team öffnen
„Wer von euch möchte das übernehmen? Neue Blickwinkel könnten uns weitere Ansätze bringen.“
(Damit setzt du die Erwartung, dass Beteiligung nicht nur von einer Person kommt.)
So baust du als Führungskraft eine gesunde Unterstützungskultur auf
Wenn im Team immer dieselben einspringen, verlierst du wertvolles Potenzial und riskierst, dass stille Leistungsträger ausbrennen. In meinem Kommunikationsworkshop für Führungskräfte und Teams entwickeln wir Strategien, wie Hilfe zur Ressource wird ohne zu überlasten.
- Klare Rollen: Wer wofür verantwortlich ist, wird transparent festgelegt.
- Gleichgewicht von Geben und Nehmen: Unterstützung wird bewusst verteilt, nicht stillschweigend erwartet.
- Wertschätzung für Ideen, nicht nur Einsatz: So fühlen sich auch die gehört, die nicht ständig einspringen.
- Nein-Kultur erlauben: Grenzen setzen wird aktiv gefördert und trainiert.
Blog-Reihe „Wenn Verhalten spricht“:
Jedes Verhalten im Team sendet eine Botschaft. Wer es deuten kann, verbessert Teamkommunikation und löst Konflikte im Team schneller.
FAQ: Helfersyndrom im Team moderieren
Wenn dieselbe Person regelmäßig Aufgaben anderer mit erledigt, eigene Projekte vernachlässigt oder keine Grenzen zieht, ist das ein klares Signal.
Weil andere Kompetenzen im Team seltener genutzt werden, Verantwortlichkeiten verschwimmen und Abhängigkeiten entstehen.
Durch klare Rollendefinitionen, bewusste Aufgabenrotation und das aktive Fördern von „Nein“-Kompetenz.
Durch transparente Prioritäten, feste Verantwortlichkeiten und das regelmäßige Überprüfen der Aufgabenverteilung in Teammeetings.